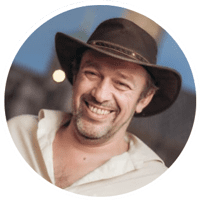Eine mobile App oder App (wörtlich Mobilgerät-Anwendung1, wobei App eine Abkürzung für den Fachbegriff Applikation ist) ist ein Computerprogramm oder eine Softwareanwendung, die für die Ausführung auf einem mobilen Gerät wie einem Telefon bzw. einem Smartphone, Tablet oder einer Uhr entwickelt wurde. Mobile Anwendungen stehen oft im Gegensatz zu Desktop-Anwendungen, die für die Ausführung auf Desktop-Computern entwickelt wurden, und Webanwendungen, die in mobilen Webbrowsern ausgeführt werden, anstatt direkt auf dem mobilen Gerät.
Es gibt sie für die verschiedensten Bereiche. Diese reichen von einfachsten Dienstprogrammen und Spaßanwendungen mit nur einer Funktion bis hin zu Programmpaketen mit umfangreicher Funktionalität wie Office-Anwendungen, Spiele, Ratgeber, Fitness-Apps, zur Emulation älterer Heimcomputer und programmierbarer Taschenrechner oder als Hilfestellung für Diabetiker. Mithilfe von mobilen Remote-Apps werden zunehmend digitale Geräte ferngesteuert, wie zum Beispiel Kameras, Action-Camcorder oder Quadrocopter. Der Großteil dieser Apps ist kostenlos, ein kleinerer Teil muss, für meist geringe Beträge, im jeweiligen App Store gekauft werden.
Apps, die mehrere Dienste in einer mobilen Anwendung kombinieren, werden als Super-Apps bezeichnet. Solche Apps haben sich besonders in Asien etabliert.
Schon die ersten Mobiltelefone enthielten oft kleine Anwendungen wie etwa Kalender, Taschenrechner oder Handyspiele. Diese waren vom Hersteller für das jeweilige Betriebssystem konzipiert, fest installiert und nur mit Root-Rechten löschbar. Mit dem Erscheinen von Java auf Mobiltelefonen (Java ME) bekamen Anwender die Möglichkeit, einfache Anwendungen und Spiele von ihrem Mobilfunknetzbetreiber oder aus dem Internet über WAP (MIDlets) herunterzuladen, die häufig schon plattformunabhängig waren. Es entwickelte sich eine Hobby-Programmiererszene, aber auch professionelle Softwarehäuser boten solche Anwendungen kostenpflichtig an. Auch auf diversen PDAs konnten Anwendungen installiert werden. Als Vorläufer von Smartphone-Apps können die Palm-OS-PDA-Anwendungen gelten, die meist nur aus einer Datei bestehen und nach dem Transfer direkt nutzbar sind. Auf Psion-Organisern konnten Programme mit dem Gerät selbst erstellt werden.
Für Mobiltelefone mit eigenem Betriebssystem und der Möglichkeit, entsprechende Apps zu installieren, setzte sich um das Jahr 2000 der Begriff Smartphone durch. Dieser Begriff wurde im Mobilbereich erstmals von Ericsson für den Prototyp GS88 verwendet. Weite Verbreitung fand um dieselbe Zeit die Communicator-Serie von Nokia, auf deren späteren Modellen das Betriebssystem Symbian lief. Zu den ersten im Massenmarkt verfügbaren Smartphones zählten 2002 das Siemens S55 und das Nokia 7650, auf denen sich Java-Programme manuell übertragen und ausführen ließen. Erst mit dem Erscheinen des Apple iPhone 2007 und später der Android-Mobiltelefone und weiteren Smartphones wurde die Möglichkeit der Installation von Anwendungen auf mobilen Geräten breiten Bevölkerungskreisen geläufiger, unterstützt durch entsprechend verstärktes Marketing der Hersteller. Auf den meisten Smartphones sind einige Apps, wie zum Beispiel ein Webbrowser, ein E-Mail-Programm und ein Kalender, bereits vorinstalliert. Im Juni 2016 wurden allein für iOS über zwei Millionen Apps angeboten.
Weltweit wurden im Jahr 2016 über 90 Milliarden Apps heruntergeladen (iOS-App-Store und Google-Play-Store). In Deutschland stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 750 Millionen Dollar. Durchschnittlich verbrachte ein Android-Smartphone-Nutzer mehr als 1,5 Stunden am Tag in Apps. Die Liste der beliebtesten Apps (die meisten Downloads) in Deutschland führt 2016 WhatsApp an, gefolgt von Facebook Messenger und Facebook-App. Den vierten Platz belegt Snapchat und auf Rang fünf folgt Instagram. Die umsatzstärksten Apps waren Lovoo, Spotify und Tinder, wenn man Spiele-Apps außer Acht lässt. Die Umsätze des Gesamtmarktes legten deutschland- und weltweit in den Folgejahren weiter stark zu. Im Jahr 2020 war nach Angaben der Analysefirma Apptopia das Videoportal TikTok die mit weltweit gut 850 Millionen Downloads erfolgreichste App (App-Store und Google Play), vor WhatsApp, der Facebook-App, Instagram und dem Videokonferenz-Tool Zoom.
Native Apps zeichnen sich dadurch aus, dass sie speziell an die Zielplattform angepasst sind. Da eine native App die Programmierschnittstellen (APIs) der Zielplattform direkt benutzt, ist die Bandbreite der Anwendungen sehr hoch. Zudem kann auf alle plattformspezifischen Hard- und Software-Funktionen zugegriffen werden, wie Dateien, GPS, Beschleunigungssensoren, Mikrofon und Kamera. Durch die verschiedenen Software-Plattformen ist es jedoch nicht möglich, etwa eine Android-App auf einem iPhone aufzuspielen oder umgekehrt. Somit muss ein Softwareunternehmen die Anwendung für jedes Endgerät einzeln entwickeln. Jede mobile Plattform besitzt ihr eigenes Software Development Kit (SDK) und ihre eigene integrierte Entwicklungsumgebung (z. B. Android Studio oder Xcode), welche von Entwicklern genutzt werden können. Die bevorzugten Programmiersprachen für die größten Systeme sind:
Mit nativen Apps können die verschiedensten Typen von Geräten auf einmal bedient werden, wenn alle auf